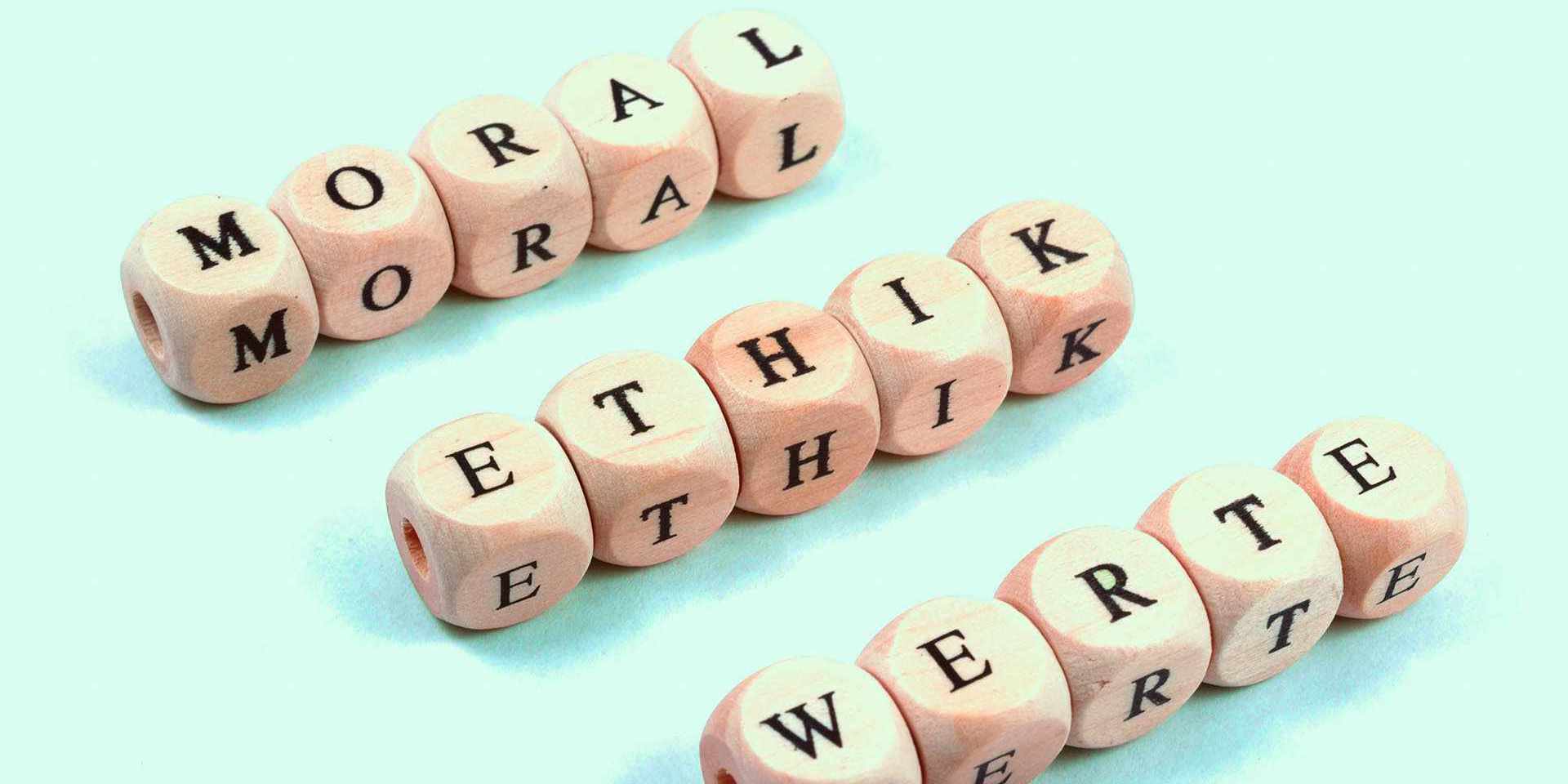Ethische Reflexion bedeutet, Normen, Werte und Verhaltensweisen kritisch zu betrachten. Dabei kann es etwa um Entscheidungen bei lebensverlängernden Maßnahmen gehen, aber auch den Umgang mit Fehlern. Ethische Fragen berühren alle im Gesundheitswesen Tätigen und gewinnen damit hohe Relevanz für den professionellen Alltag. In diesem Abschnitt werden ethischen Reflexionsformen und Begriffe in Gesundheitsberufen vorge-stellt. Unter dem Aspekt der Patientenautonomie werden Probleme der Kommunikation und Einwilli-gungsfähigkeit beleuchtet. Die Betrachtung widmet sich zudem Vor- und Nachteilen von Patientenver-fügungen.
Ethische Grundlagen der onkologischen Versorgung
Theda Rehbock
Ethik wird im Allgemeinen als das Bemühen um Reflexion, Begründung oder Kritik herrschender moralischer, sozialer, institutioneller oder rechtlicher Grundsätze, Maximen oder Normen verstanden, die in verschiedenen Lebensbereichen unser Verhalten und Handeln leiten und orientieren. So verstanden ist Ethik eine Disziplin der Philosophie; sie ist von der in einer Gesellschaft herrschenden Moral, dem in einem Staat herrschenden Recht oder dem herrschenden Ethos, wie etwa dem Ethos der Gesundheitsberufe, zu unterscheiden, sofern die Moral, das Recht oder das Ethos Gegenstand ethischer Reflexion oder Kritik sind.
Ethik ist also auch im Fall etwa des ärztlichen oder pflegerischen Berufes nicht gleichzusetzen mit dem Berufsethos, wie es im Hippokratischen Eid, dem Genfer Ärztegelöbnis (1948) oder dem Florence-Nightingale-Gelübde (1886) zu finden ist, auch nicht mit Berufskodizes oder Standesregeln oder mit dem das ärztliche oder pflegerische Handeln regelnden allgemeinen Recht. All diese Regelungen können höchst problematisch und kritikbedürftig sein, herrschendes Recht kann sich als Unrecht erweisen.
Moralität und Gewissen des Einzelnen
Für die Rechtfertigung des Handelns reicht es nicht, sich auf herrschende Traditionen und Autoritäten wie die Kirche, den Staat oder etwa das Standesrecht eines Berufes zu berufen. Es bedarf immer von Neuem der kritischen Reflexion und Prüfung der herrschenden Regeln und der üblichen Praxis.
Philosophische Ethik ist, wie die Philosophie überhaupt, nicht lediglich eine akademische Disziplin, sondern eine allgemeinmenschliche Praxis. Ethische Reflexion und Kritik ist keine Expertenangelegenheit, sie ist nicht an Spezialisten für Ethik zu delegieren. Das hat auch damit zu tun, dass Ethik sich nicht nur auf äußere Normen und Gesetze bezieht, sondern immer zugleich auf die Moralität (Kant), das heißt auf die Einstellung, Haltung oder Orientierung des Einzelnen, wie sie sich im Gewissen manifestiert. Damit ist nicht das „gute“ oder „schlechte Gewissen“ gemeint, sondern das Gewissen, das man nicht hat, wenn man „gewissenlos“ handelt. Gewissenlos handelt zum Beispiel derjenige, der sich nur aus Angst vor Strafe an herrschende Gesetze oder Verhaltensregeln hält, ohne sich darum zu kümmern, ob es sich dabei um wirklich legitime Gesetze und gute Regeln handelt.
1 Ethik (in) der Medizin – Ethik (in) der Pflege
Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sich „Bereichsethiken“ herausgebildet, in denen es um die ethische Reflexion und Kritik der normativen Grundlagen verschiedener gesellschaftlicher Bereiche geht. Dazu gehören auch die Medizin, die Pflege und letztlich alle Gesundheitsberufe [1–5]. Anlass und Motivation für ethische Reflexion sind hier:
- der Missbrauch der Medizin (z. B. im Nationalsozialismus), der zu den Nürnberger Ärzteprozessen, dem Nürnberger Kodex (1947), dem Genfer Ärztegelöbnis (1948), der Deklaration von Helsinki (1964) u. a. m. sowie insbesondere zur Einführung der aufgeklärten Einwilligung oder informierten Zustimmung (informed consent) von Probanden zur Teilnahme an medizinischen Experimenten sowie von Patienten zu medizinischen Maßnahmen führte;
- die Zunahme ethischer Entscheidungskonflikte aufgrund des medizinischen Fortschritts, z. B. in Fragen des Verzichtes auf oder Abbruchs von lebensverlängernden Maßnahmen am Lebensende;
- eine zunehmend kritische Haltung in der Gesellschaft gegenüber der naturwissenschaftlich-technischen Orientierung der modernen Medizin (Schulmedizin, Apparatemedizin);
- die selbstkritische Auseinandersetzung der Gesundheitsberufe mit ihrem eigenen traditionellen Selbstverständnis, insbesondere mit bevormundender „paternalistischer“ Fürsorge;
- die wachsende Emanzipation nichtärztlicher Berufe, insbesondere der Pflege, gegenüber der ärztlich dominierten Medizin und Medizinethik;
- das Leiden der im Gesundheitswesen Tätigen an der täglich erfahrbaren Diskrepanz zwischen der ethischen Ausrichtung ihres Tuns und der dahinter weit zurückbleibenden Realität, auch als „moral distress“ oder „ethisches Unwohlsein“ bezeichnet, das krank machen kann, indem es zu Burn-out, Selbstausbeutung, Resignation und Frustration, vorzeitigem Ausscheiden aus dem Beruf und Ähnlichem führt, und auch straffälliges Verhalten wie „Krankenmorde“ aus vermeintlichem Mitleid zur Folge haben kann.
Es gibt mittlerweile zahlreiche überregionale und regionale Institutionen, die sich der Reflexion ethischer Fragen der Medizin bzw. der Gesundheitsberufe widmen. Besonders wichtig und bekannt ist in Deutschland die multiprofessionell und interdisziplinär ausgerichtete Akademie für Ethik in der Medizin (Göttingen).
2 Formen ethischer Reflexion
Es haben sich mittlerweile verschiedene Formen ethischer Reflexion herausgebildet, dazu gehört insbesondere die sogenannte ethische Fallbesprechung [6, 7]. Dabei geht es um die ethische Analyse und Diskussion individueller Fälle aus der Praxis der Gesundheitsberufe, die ein besonderes ethisches Problem aufwerfen.
Im Zentrum stehen typischerweise Entscheidungskonflikte, zum Beispiel: Soll eine medizinische Maßnahme – künstliche Beatmung, künstliche Ernährung, palliative Sedierung oder Ähnliches – begonnen, abgebrochen oder weitergeführt werden? Wie soll mit einer Patientenverfügung umgegangen werden?
Ethische Probleme können aber auch sehr viel alltäglicher, „normaler“, in den Fällen stärker verborgen sein: Wie wird etwa üblicherweise mit „Fehlern“ umgegangen? Werden sie aus Angst vor Konsequenzen eher vertuscht oder können sie offen ausgesprochen werden, sodass aus ihnen gelernt werden kann? Wie werden Patientinnen und Patienten informiert und aufgeklärt, wie wird mit ihnen, mit Zugehörigen oder mit Kollegen und Kolleginnen kommuniziert? Diese und ähnliche Fragen werden oft anlässlich ethischer Fallbesprechungen zum Thema der Diskussion. Sie betreffen nicht nur das individuelle Verhalten, sondern sind oft struktureller Natur.
Ethikberatung
Ethische Fallbesprechungen werden vor allem in der Aus- und Weiterbildung der Gesundheitsberufe sowie in der klinischen Praxis praktiziert, hier insbesondere im Rahmen der Ethikberatung [8], die sich seit den 1990er-Jahren an Krankenhäusern, Universitätskliniken, Alten- und Pflegeheimen, Hospizen und Palliativstationen langsam entwickelt. Ethikberatung erfolgt mithilfe von Klinischen Ethikkomittees sowie „vor Ort“, etwa in „Ethikforen“ oder „Fallkonferenzen“ auf der Station. Durch Ethikberaterinnen und -berater moderiert oder selbst organisiert kann hier über aktuell schwierige Entscheidungssituationen, aber auch regelmäßig und retrospektiv über Fragen und Fälle beraten werden, die von den Beteiligten als belastend, konfliktreich oder ethisch problematisch erfahren wurden.
3 Ethische Grundbegriffe (Prinzipien)
Worauf können sich Urteile, dass etwas getan oder nicht getan werden sollte, dass etwas gut oder schlecht gelaufen ist, als Maßstab berufen? In der ethischen Reflexion geht es nicht nur darum, individuelles Verhalten oder Handeln zu beurteilen, sondern übliche Praktiken, Normen oder Wertvorstellungen auf verschiedenen Ebenen der Kritik zu unterwerfen und gegebenenfalls Vorschläge zur Veränderung zu machen.
Wie ist zum Beispiel eine Chemoambulanz organisiert? Wie wird mit Patienten und Patientinnen kommuniziert? Wie kompetent, individuell und intensiv werden sie im Hinblick auf den Umgang mit Nebenwirkungen informiert und beraten? Um diese Fragen in ethischer Hinsicht zu beantworten, bedarf es immer auch übergeordneter ethischer Grundbegriffe oder Prinzipien mit einem Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit. Dazu gehören die Begriffe der Würde, der Person, der Freiheit und Autonomie oder Selbstbestimmung. Die Würde des Patienten oder der Patientin als Person zu achten, bedeutet, ihn oder sie als Person mit individuellen Lebensumständen, Wünschen und Bedürfnissen sowie mit einem Anspruch auf einen freien und selbstbestimmten Umgang mit seiner oder ihrer Krankheit zu betreuen und zu respektieren.
In der Medizinethik dient bis heute der Vier-Prinzipien-Ansatz von Tom L. Beauchamp und James F. Childress [9] als Orientierungsrahmen für ethische Reflexion.
| Zusätzlich zu den traditionellen Prinzipien ärztlichen Handelns – vor allem nicht schaden (non-maleficence) und Sorge für Gesundheit und Wohl des Patienten (beneficence) – werden hier die Achtung der Autonomie (respect for autonomy) und die Gerechtigkeit (justice), vor allem im Sinne der Gerechtigkeit bei der Verteilung knapper Ressourcen, als Prinzipien benannt. |
4 Autonomie (von Patientinnen und Patienten) als höchstes Prinzip?
Das Prinzip der Autonomie ist Grundlage für die rechtliche Forderung des informed consent (aufgeklärte Einwilligung, informierte Zustimmung). Dieser Forderung gemäß sind medizinische Maßnahmen nur dann zulässig, wenn Patienten und Patientinnen – im Zustand der Einwilligungsfähigkeit und auf der Grundlage hinreichender Information und Aufklärung – den Maßnahmen zugestimmt haben. Es ist jedoch sehr fraglich und wird viel diskutiert, ob sie durch die übliche formell geregelte Praxis mit Aufklärungsgesprächen, Aufklärungsbögen usw. wirklich in die Lage versetzt werden, eine Entscheidung zu treffen, die ihrem Willen und ihren eigenen Vorstellungen von einem guten Leben, vor allem auch am Ende des Lebens und unter Bedingungen unheilbarer Krankheit, entspricht.
Für eine gute Entscheidungsfindung ist es ausschlaggebend, in welcher Form, wie intensiv und verständlich, und wie individuell über die Ergebnisse diagnostischer Maßnahmen, Prognosen, ärztliche und pflegerische Therapieempfehlungen sowie mögliche andere Optionen informiert und aufgeklärt, beraten und kommuniziert wird.
Zu solchen Optionen gehört unter Umständen auch – was manchmal vergessen wird – der völlige Verzicht auf eine empfohlene Therapie, über dessen mögliche Folgen unvoreingenommen zu informieren ist. Es fehlt oft das Bewusstsein dafür, dass die nach medizinischen und pflegerischen Kriterien bestmögliche Therapie keineswegs die für die Patientin oder den Patienten beste sein muss. In seiner oder ihrer individuellen Lebenssituation und gemäß den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Einstellungen können ganz andere Kriterien im Vordergrund stehen. Vielleicht möchte er oder sie statt der Therapie, ggf. mithilfe palliativer Betreuung, eine Weltreise machen und lieber bald danach sterben, statt sich lang andauernden, belastenden onkologischen Therapien mit ungewisser Aussicht auf „Heilung“ oder längeres Überleben zu unterziehen [10].
Der Anspruch auf Information, Aufklärung und eigene Entscheidungen bezieht sich nicht lediglich auf die „großen“ Diagnosen und Therapiemaßnahmen. Auch scheinbar geringfügige Maßnahmen – zum Beispiel ein Umgang mit Nebenwirkungen, der persönlichen Bedürfnissen und Lebensumständen gerecht wird – können für die Betroffenen große Bedeutung haben.
Einwilligungs(un)fähigkeit von Patientinnen und Patienten
Doch sind Patienten und Patientinnen unter dem Eindruck oder Einfluss ihrer Krankheit nicht oft viel zu ängstlich, verwirrt, depressiv gestimmt und kognitiv eingeschränkt, und unter Umständen ganz unfähig, Sinn und Zweck medizinischer Maßnahmen wirklich einzuschätzen und zu beurteilen? Kann es nicht unter bestimmten Umständen doch zulässig, ja geboten sein, gegen ihren Willen oder gar Widerstand aus Gründen der Fürsorge (beneficence) eine medizinische Maßnahme durchzuführen, um sie sozusagen vor sich selbst zu schützen?
Es scheint, dass paternalistisches Eingreifen desto notwendiger ist, je weniger einwilligungsfähig (competent) die Patientin oder der Patient ist und je mehr für seine Gesundheit und sein Überleben auf dem Spiel steht. Einwilligungs(un)fähigkeit wird ggf. mittels psychiatrischer oder kognitiver Testverfahren festgestellt. Doch wo genau sind die Grenzen zu ziehen? Gibt es nicht auch ein Recht auf (scheinbar) irrationale Entscheidungen? Zu berücksichtigen ist, dass mangelnde Urteils- und Entscheidungsfähigkeit kein Freibrief ist für medizinisch- und pflegerisch-paternalistisches Handeln. Die notwendige Fürsorge hat unter diesen Bedingungen vielmehr umso mehr die Person, den (mutmaßlichen) Willen, die individuelle Situation im Auge zu behalten und sich im Handeln daran zu orientieren. Nonverbales Verhalten (Mimik, Gestik, Ausdrucksverhalten), zum Beispiel durch Zurückweisung von Essen und Trinken, Aussagen von Zugehörigen oder schriftliche Verfügungen können ebenso Ausdruck des Willens und der Bedürfnisse sein, die zu berücksichtigen sind, wie aktuelle, „kompetente“ Willensäußerungen.
5 Patientenverfügung
Seit einiger Zeit ist die Patientenverfügung zu einem rechtlichen Instrument geworden, mit dem Patienten und Patientinnen ihre Selbstbestimmung auf zukünftig mögliche Zeiten der Nicht-Einwilligungsfähigkeit (wegen Bewusstlosigkeit, Koma, schweren kognitiven Störungen, schwerer psychischer Krankheit oder Demenz usw.) ausdehnen können, indem sie schriftlich verfügen, welche medizinischen Behandlungen sie unter welchen Bedingungen akzeptieren oder ablehnen [11]. Die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen ist in Deutschland im Betreuungsrecht (§ 1901a BGB) geregelt.
Der Umgang mit Patientenverfügungen im medizinischen Alltag ist allerdings mit einer Reihe von Schwierigkeiten verbunden. Es ist für die Verfügenden schwer, sich mögliche zukünftige Situationen hinreichend konkret vorzustellen und die hierfür (nicht) gewünschten Maßnahmen hinreichend genau festzulegen. Es fehlt oft die dafür notwendige medizinische Beratung. Es kann geschehen, dass sich seit Abfassung der Patientenverfügung die Bedürfnisse, Wünsche oder Lebensumstände verändert haben, ohne dass die Betreffenden daran gedacht oder noch die Möglichkeit dazu hatten, ihre Verfügung entsprechend zu ändern. Eine Patientenverfügung ist desto sinnvoller, je konkreter sich ein bestimmter möglicher Krankheitsverlauf bereits abzeichnet. Damit sie nicht nur oberflächlich zur Kenntnis genommen und schematisch angewendet wird, sondern ihren Zweck wirklich erfüllen kann, muss zudem auch die Umsetzung des Patientenwillens im Kontext intensiver Beratung und Kommunikation zwischen allen Beteiligten erfolgen. Oft ist es ratsamer, mittels einer Bevollmächtigung (Vorsorgevollmacht) eine nahestehende Person in die Lage zu versetzen, dass sie stellvertretend – gemäß dem schriftlich verfügten, mündlich mitgeteilten oder mutmaßlichen Willen – die notwendigen Entscheidungen treffen kann.
6 Person – Sprache – Kultur (anthropologische Grundlagen)
Für eine im ethischen Sinne gute medizinische und pflegerische Praxis der onkologischen Versorgung, für eine gute ethische Kultur der Medizin und Pflege, reicht es also nicht aus, dass die handelnden Personen sich an die herrschenden Regeln und Gepflogenheiten halten. Es ist vielmehr notwendig, dass sich jeder und jede Einzelne, unabhängig von Ausbildung oder Fachkompetenz, im berufspraktischen Verhalten, Handeln und Urteilen von einer moralischen Grundeinstellung oder Haltung (Moralität und Gewissen) leiten lässt, die sich an übergeordneten ethischen Prinzipien orientiert. Diese Aufgabe läuft letztlich auf die Frage hinaus, was es heißt, gut und richtig zu leben – vor allem auch im Umgang mit Krankheit, Verletzlichkeit und Sterblichkeit, angesichts der Endlichkeit menschlicher Existenz – und wie wir unser Leben und Sein als Menschen verstehen [3].
Würde und Autonomie wahren
Das menschliche Selbstverständnis als Person mit einem Anspruch auf Achtung ihrer Würde und Autonomie ist unter Bedingungen der modernen Medizin besonders gefährdet. Unter dem Einfluss des naturwissenschaftlichen und medizinisch-technischen Fortschritts hat sich eine medizinische Praxis, Sprache und Haltung entwickelt, in der „der Patient“ als bloßes Objekt medizinischer Behandlung und Forschung sowie als bloßer Fall einer Krankheit gesehen und gemäß allgemeinen Krankheitsbegriffen, Leitlinien und standardisierten Therapiemethoden behandelt wird.
Im Interesse einer verlässlichen wissenschaftlichen Basis medizinischer Behandlung ist diese Form der Medizin notwendig. Aber es besteht gerade deshalb die Gefahr, Kranke als Personen mit bestimmten moralischen Ansprüchen und als Menschen mit einem bestimmten individuellen Leben aus dem Auge zu verlieren. Damit wird auch ihre Würde als Person missachtet. Diese Gefahr manifestiert sich in der Anonymität medizinischer Institutionen, deren Einrichtungen und Abläufe sich weniger an Bedürfnissen von Patienten und Patientinnen als an Erfordernissen der Effizienz des Betriebes orientieren.
Damit ist zugleich die Würde und Autonomie der in diesem Betrieb beruflich Tätigen bedroht, sofern sie gehindert werden, gemäß ihrer moralischen Grundorientierung zu handeln. Autonomie bedeutet – entgegen einem auch in der Medizin- und Pflegeethik verbreiteten Verständnis – nicht lediglich die individuelle Freiheit, den privaten Wünschen und Wertvorstellungen zu folgen. Moralische Autonomie, im Sinne Immanuel Kants, schließt vielmehr die moralische Verantwortung für die Freiheit und das gute Leben aller anderen ein. In diesem Sinne ist Autonomie nicht nur Patienten und Patientinnen, sondern allen Beteiligten gleichermaßen zuzugestehen und von allen zu fordern.
Verständliche Sprache in Beratung und Kommunikation
Was heißt es konkret, Erkrankte als Person zu achten? Es ist dafür notwendig, die engen Bedingungen und Grenzen der naturwissenschaftlich-technischen Methoden und besonders der damit einhergehenden Sprache kritisch zu reflektieren.
Anlässlich ethischer Fallbesprechungen ist immer wieder festzustellen, dass ein rein medizinischer Fallbericht erst in „gewöhnliche“ Sprache „übersetzt“ werden muss, damit die ethische Problematik sichtbar wird und besprochen werden kann. Dazu bedarf es der gemeinsam geteilten Alltagssprache im Kontext einer gemeinsam geteilten Lebenspraxis. In diesem Rahmen ist alle Ungleichheit und Asymmetrie zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen ebenso aufgehoben wie die Ungleichheit zwischen den verschiedenen Gesundheitsberufen, zum Beispiel zwischen Ärzten und Pflegenden, oder zwischen beruflich und ehrenamtlich Tätigen. Nur so ist es den im Gesundheitswesen tätigen Personen möglich, der individuellen Lebenssituation der einzelnen Patienten und Patientinnen, mit ihren sehr verschiedenen und unter Umständen sehr fremden biographischen, sozialen und kulturellen Hintergründen und Sprachen gerecht zu werden, sie auch in ihrem Anderssein und Fremdsein und damit in ihrer Würde als Personen zu achten.
Damit dies möglich wird, sind nicht feste Regeln, Schemata oder Normen notwendig, wie sie den medizinischen Betrieb beherrschen, sondern eine lebendige Kultur ethischer Reflexion, schon in der Ausbildung, erst recht in der Praxis. Ethische Kultur der Medizin beinhaltet sowohl die individuelle moralische Autonomie und Verantwortung als auch die Kommunikation und Beratung zwischen allen Beteiligten, sowie einen möglichst großen Spielraum für individuelles, kreatives, nicht „von oben“ gesteuertes Handeln.
Literatur
- Monteverdi S (Hrsg) (2020) Handbuch Pflegeethik. Ethisch denken und handeln in den Praxisfeldern der Pflege. Kohlhammer, Stuttgart
- Pöltner G (2006) Grundkurs Medizin-Ethik. UTB, Wien
- Rehbock T (2005) Person sein in Grenzsituationen. Zur Kritik der Ethik medizinischen Handelns. Mentis, Paderborn
- Rüegger H (2003) Sterben in Würde? Nachdenken über ein differenziertes Würdeverständnis. Nzn Buchverlag, Zürich
- Schöne-Seifert B (2007) Grundlagen der Medizinethik. Kröner, Stuttgart
- Arbeitsgruppe „Pflege und Ethik“ der Akademie für Ethik in der Medizin e. V. (2005) „Für alle Fälle…“. Arbeit mit Fallgeschichten in der Pflegeethik. Hannover
- Steinkamp N, Gordijn B (2009) Ethik in Klinik und Pflegeeinrichtung: Ein Arbeitsbuch. Wolters Kluwer, München
- Dörries A, Neitzke G, Simon A, Vollmann J (2010) Klinische Ethikberatung – Ein Praxisbuch für Krankenhäuser und Einrichtungen der Altenpflege. Kohlhammer, Stuttgart
- Beauchamp TL, Childress JF (2001) Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, Oxford
- Noll P (1987) Diktate über Sterben & Tod. Piper, München
- Klie T, Student JC (2008) Die Patientenverfügung. Was Sie tun können, um richtig vorzusorgen. Herder, Freiburg